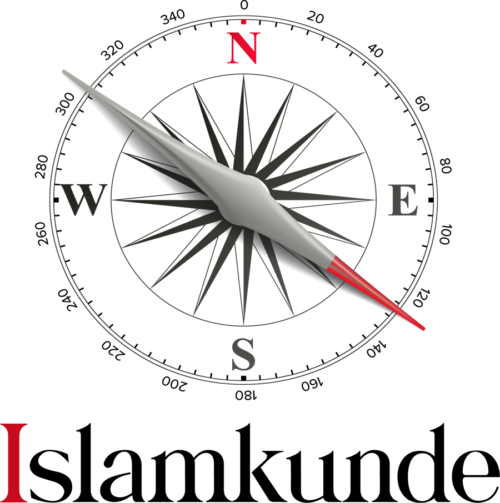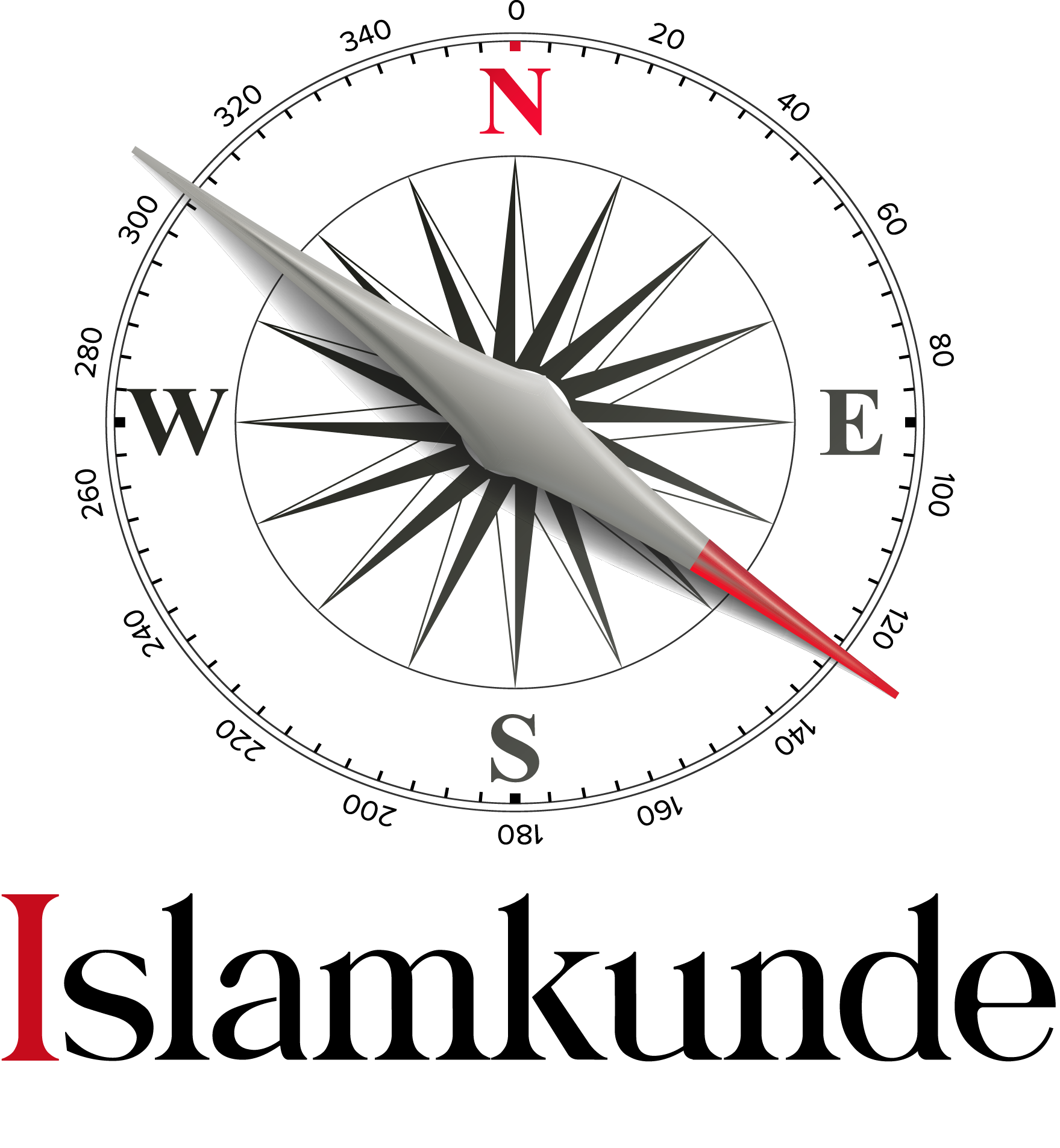Prof. Dr. Abdulkarim Germanus ist ein weltberühmter Professor für Orientalische Studien an der Budapester Universität. Während des Ersten und Zweiten Weltkriegs bereiste er Indien und lehrte eine Weile an der von Tagore geleiteten „Schanti Naketen“ Universität. Später ging er nach Indien und wurde in der „Dschamia Milliie“ Muslim. Prof. Germanus gilt als eine Autorität besonders für die türkische Sprache und türkische Literatur.
Es war an einem regnerischen Nachmittag in meiner Jugend, als ich in einer alten Illustrierten blätterte. Darin befanden sich Bilder weit entfernter Länder. Eine Zeitlang blätterte ich gleichgültig in den Seiten, als mein Blick auf einen Holzschnitt fiel. Das Bild stellte Häuser mit flachen Dächern dar, aus denen sich hier und da runde Kuppeln sanft gegen den dunklen Himmel erhoben, der nur durch die Mondsichel erhellt wurde. Auf einem Dach waren die schattenhaften Umrisse sitzender Männer, angetan mit prächtigen Gewändern zu sehen. Das Bild fesselte meine Phantasie. Es unterschied sich so stark von den herkömmlichen europäischen Landschaften: Es war eine orientalische Szene, irgendwo im arabischen Osten, wo ein Geschichtenerzähler seine in Burnusse gekleideten Zuhörer mit lustigen Geschichten erfreute. Die Darstellung war so realistisch, dass ich mir vorstellte, mit den arabischen Zuhörern auf dem Dach zu sitzen, die melodische Stimme des Erzählers zu hören. Dieses Bild gab meinem Leben eine Richtung. Ich begann die türkische Sprache zu lernen, denn nun war mein Interesse für den Orient geweckt. Bald wurde mir klar, dass die literarische türkische Sprache nur wenige türkische Wörter aufweist. Die Poesie wird durch persische Ausrücke bereichert, die Prosa beinhaltet viele arabische Elemente. Ich beschloss, alle drei Sprachen zu lernen, um mir Zugang zu dieser geistigen Welt zu verschaffen, die solch strahlendes Licht über die Menschheit verbreitete. Während eines Sommers hatte ich das Glück, nach Bosnien reisen zu können, dem orientalischen Land, das meinem Heimatland am nächsten liegt. Sobald ich mich in einem Hotel einquartiert hatte, rannte ich los und fragte, wo man Muslime finden konnte, und mir wurde ein Ort genannt. Ich ging dorthin. Ich konnte das Türkische mehr schlecht als recht und fragte mich, ob ich mich mit ihnen würde verständigen können. Im muslimischen Viertel fand ich bald ein bescheidenes Café, in dem sich ein paar Bosnier auf niedrigen Strohstühlen ihren Wohlbehagen zu Gemüte führten. Sie trugen die traditionellen weiten Hosen, die in der Mitte mit einem breiten Gürtel zusammengefasst wurden, an dem eine Unzahl Dolche baumelten, und waren ernstblickende, großgeratene Leute. Ihr Kopfbedeckungen und die fremdartigen Gewänder verliehen ihnen den Anschein von Streitsüchtigkeit. Mit klopfendem Herzen betrat ich das Café und setzte mich schüchtern in einer weit entfernten Ecke nieder. Die Bosnier beäugten mich neugierig und plötzlich fielen mir all die haarsträubenden Geschichten über die muslimische Intoleranz ein, die ich in fanatischen Büchern gelesen hatte, und wie sie Christen ermordeten. Meine kindliche Phantasie malte Schreckgespenster an die Wand: Sicherlich würden die Männer gleich ihre Dolche ziehen und auf mich, den unerwünschten Eindringling, losstürzen, und ich bereute es, hierher gekommen zu sein. Ich wünschte mir nur, heil aus diesem Raum hinauszukommen, doch wagte ich nicht, mich zu rühren. Doch nach wenigen Sekunden brachte mir der Kellner eine Tasse duftenden Kaffees, zeigte auf die angsterregende Gruppe von Männern und sagte, es sei ein Geschenk jener Muslime, vor denen ich so erschrocken war. Ich wendete ihnen mein angstvolles Gesicht zu, als einer von ihnen ein sanftes „Salam“ sprach und mir freundlich zulächelte. Zögernd zwang ich meinen verkrampften Mund zu einem Lächeln. Die eingebildeten „Feinde“ erhoben sich langsam und kamen auf meinen kleinen Tisch zu.
Was jetzt? – flüsterte mein zitterndes Herz – werden sie mich nun angreifen? Ein zweites „Salam“ folgte und sie setzten sich um mich. Einer von ihnen bot mir eine Zigarette an, und in ihrem flackernden Licht stellte ich fest, dass sich hinter dem kriegerischen Aussehen der Männer eine sehr gesegnete Seele verbarg. Ich nahm allen Mut zusammen und sprach die Männer mit meinem primitiven Türkisch an. Das wirkte wie Zauber. Ihre Gesichter strahlten in Freundlichkeit, ja, in Zuneigung auf – und statt Feindseligkeit zu zeigen, luden sie mich in ihre Häuser ein, und statt der fälschlich erwarteten Dolche überhäuften sie mich mit Wohlwollen. Das war mein erstes Zusammentreffen mit Muslimen. Viele Jahre sind seither vergangen und ich habe eine reiche Abwechslung von Ereignissen, Reisen und Studien erlebt. Jede Reise eröffnete vor meinen neugierigen Augen neue Ausblicke. Ich durchquerte alle Länder Europas, studierte an der Universität von Istanbul und bewunderte die historischen Schönheiten in Kleinasien und Syrien. Ich hatte Türkisch, Persisch und Arabisch gelernt und den Lehrstuhl für Islamische Studien an der Universität von Budapest erworben. All das trockene und greifbare Wissen, das sich im Laufe der Jahrhunderte angehäuft hatte, all die tausenden von Seiten der Bücher hatte ich mit gierigen Augen verschlungen – aber meine Seele blieb durstig. Je mehr ich diese Bücher studierte, desto stärker drang der Islam in mein Herz ein und ich blieb unter ihrem [speziell des edlen Qur’ân und der ehrwürdigen Hadîth-Bücher] Einfluss. Schließlich entschloss ich mich, wieder in den Orient zu reisen, um den Islam aus der Nähe zu studieren. Diese Reise brachte mich nach Indien. Mein Geist war gesättigt, aber meine Seele litt Durst. Eines Nachts in Delhi erschien mir im Traum der Prophet Muhammed, Friede sei mit ihm, sein Gewand war einfach, aber auserlesen, und ein angenehmer Duft entströmte ihm. Sein Gesicht war höflich, sehr schön, liebenswürdig und in seinen Augen erglänzte ein edles Feuer, und er sprach mich mit seiner süßen, aber männlich gebietenden Stimme arabisch an: „Warum machst du dir Sorgen? Der wahre Weg liegt vor dir, so sicher wie das Angesicht der Erde. Schreite nur mutig vorwärts, mit der Kraft des Glaubens.“ „O Gesandter Allahs, des Erhabenen, an den ich nun glaube“, rief ich zitternd in meinem Fiebertraum auf Arabisch, „du hast auf himmlischen Geheiß alle Feinde besiegt, und deine Mühe wurde mit Ruhm gekrönt. Aber ich muss noch leiden und wer weiß, wann ich Ruhe finde?“ Er blickte mich ernst an und versank dann in Gedanken, aber nach einer Weile sprach er wiederum. Sein Arabisch war so klar, dass jedes Wort wie eine Silberglocke erklang. Sein prophetisches Wort, das Allahs, des Erhabenen, Befehl beinhaltete, fiel mit erdrückender Gewalt auf meine Brust herab: „Haben Wir nicht die Erde zu einem Bette gemacht und die Berge zu Pflöcken? Und Wir haben euch in Paaren erschaffen. Und Wir haben euch den Schlaf zur Ruhe gemacht.“ „Ich kann nicht schlafen, mein Gott“, stöhnte ich voller Schmerz. „Ich kann die Geheimnisse, die mit undurchdringlichen Schleiern umgeben sind, nicht lüften. Hilf mir, Muhammed, Prophet Allahs, des Erhabenen! Hilf mir!“ Ein wilder Schrei drang stoßweise aus meiner Brust. Ich schlug unter der Last meines Traumes wild um mich – ich fürchtete mich davor, den Propheten zu betrüben. Dann schien mir, als ob ich in die Tiefe sank – und dann erwachte ich. Das Blut hämmerte mir in den Schläfen, mein Körper war in Schweiß gebadet, und ich fühlte mich sehr traurig und einsam.
Der darauffolgende Freitag wurde Zeuge einer eigenartigen Szene im riesigen Dschumua Masdschid von Delhi. Ein blonder, bleichgesichtiger junger Fremdling bahnte sich, begleitet von einigen älteren Männern, einen Weg durch die drängende Schar von Gläubigen. Ich war das, und ich trug ein indisches Gewand, und ich hatte an meiner Brust einen goldenen türkischen Orden befestigt, die mir in Istanbul überreicht worden waren. Die Gläubigen starrten mich erstaunt und überrascht an. Unsere kleine Gruppe schritt geradewegs auf die Kanzel zu. Plötzlich ertönte der Adhân. Viertausend Männer erhoben sich, wie Soldaten zusammengedrängt in dichten Reihen sprachen sie ehrfurchtsvoll ihre Gebete – und ich als einer von ihnen. Es war ein erhabener, für mich unvergesslicher Augenblick. Nachdem die Khutba verlesen war, fasste mich Abdulhayy bei der Hand und führte mich zur Mimbar. Ich musste meine Schritte sorgfältig wählen, um nicht auf jemanden, der am Boden hockte, zu treten. Der große Augenblick war eingetreten. Ich stand auf den Stufen der Mimbar. Die riesige Menge der Männer begann sich zu bewegen. Tausende von Häuptern, mit Turbanen bekleidet, verwandelten sich in eine Blumenwiese, die sich mir neugierig zuwandte. Gelehrte mit grauen Bärten umringten mich und blickten mich ermutigend an. Sie übertrugen eine ungewöhnliche Ruhe auf mich und so erstieg ich langsam die Mimbar. Von oben überblickte ich die unübersehbare Menschenmenge, die wie das lebendige Meer unter mir wogte. Alle hatten ihre Häupter erhoben und betrachteten mich aufmerksam. „O ihr edlen Herrschaften“, begann ich auf Arabisch. „Ich komme aus weiter Ferne, um mir Wissen anzueignen, das ich zu Hause nicht bekommen konnte. Hier habe ich gefunden, was ich suchte, und meine Seele hat nun Frieden gefunden.“ Ich fuhr fort und sprach von dem Auftrag des Islam in der Weltgeschichte und von dem Wunder, das Allah, der Erhabene, mit Seinem Propheten vollbracht hat. Ich sprach über den Rückgang, den die Muslime heutzutage erfahren, und von den Mitteln, mit deren Hilfe ein neuer Aufstieg herbeigeführt werden könnte. Es ist zwar ein Sprichwort des Muslims, dass alles von Allahs, des Erhabenen, Wille abhänge, doch einige Muslime missverstehen das so, dass der Mensch oft nichts aus eigenem Vermögen tun kann und dass man daher nicht zu arbeiten brauche, weil alles von Allah, dem Erhabenen, komme und der Mensch dies nicht ändern könne, aber der edle Qur‘ân sagt auch, dass „Gott die Lage der Menschen nicht verbessern würde, wenn sie nicht ihr Verhältnis zu sich ändern“. Ich baute meine Rede auf diesem Satz aus dem edlen Qur‘ân auf und schloss mit der Lobpreisung des frommen Lebens und des Kampfes gegen das Schlechte. Dann setzte ich mich.
Als ich mich von der Mimbar entfernte, ertönte ein lautes „Allahu Akbar“, das aus jedem Winkel der Moschee erklang. Die Spannung war überwältigend. Ich kann mich kaum an etwas mehr erinnern, als dass mein Begleiter Aslan mich von der Mimbar herunterholte, mich beim Arm nahm und aus der Moschee hinauszog. „Weshalb diese Eile“, fragte ich. Er sagte: „Schau hinter dich!“ Ich drehte mich um und sah, dass die ganze Gemeinde hinter mir herkam und versuchte mich einzuholen, was ihnen schließlich auch gelang. Männer standen vor mir und umarmten mich, einige versuchten meine Hand zu küssen. Manche baten um meinen Segen. „O Allah, der Erhabene“ rief ich aus, „gestatte diesen unschuldigen Seelen nicht, mich über sie zu erheben!“ Die Seufzer und Hoffnungen dieser unschuldigen Menschen beschämten mich, als ob ich gestohlen oder betrogen hätte. Welche schreckliche Last es doch für einen Staatsmann bedeuten muss, wenn sich ihm die Menschen anvertrauen, von ihm Unterstützung erhoffen und ihn höher einstufen als sich selbst!
Aslan befreite mich von den Umarmungen meiner neuen Brüder, setzte mich in eine Tonga und fuhr mich nach Hause. Am folgenden Tag und an den weiteren Tagen kamen die Menschen scharenweise zu mir, um mir zu gratulieren, und ich wurde mit so viel Wärme und Zuneigung überschüttet, dass ich davon ein Leben lang zehren kann.